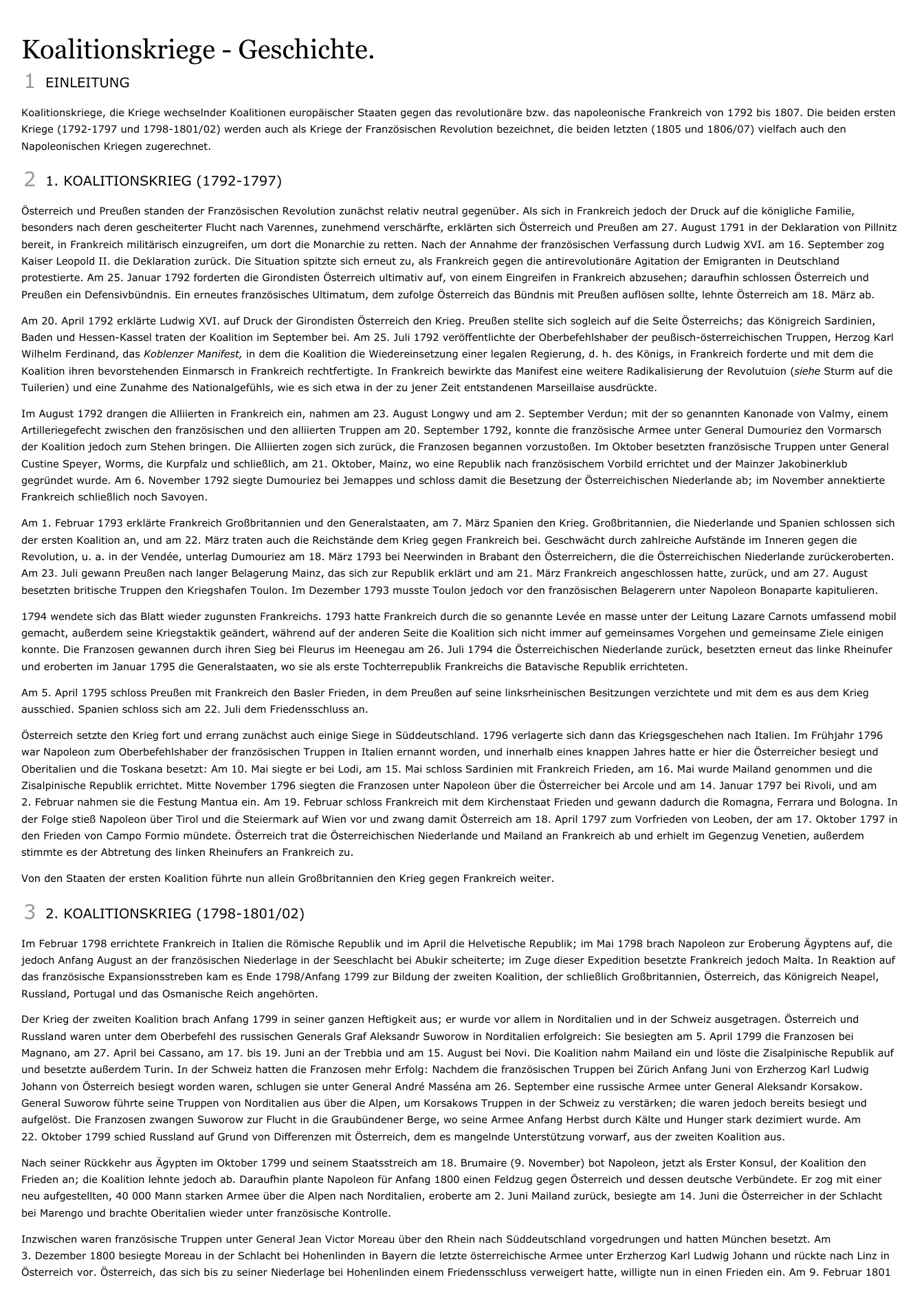Koalitionskriege - Geschichte.
Publié le 06/12/2021
Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Koalitionskriege - Geschichte.. Ce document contient 2249 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Echange
Koalitionskriege - Geschichte.
1
EINLEITUNG
Koalitionskriege, die Kriege wechselnder Koalitionen europäischer Staaten gegen das revolutionäre bzw. das napoleonische Frankreich von 1792 bis 1807. Die beiden ersten
Kriege (1792-1797 und 1798-1801/02) werden auch als Kriege der Französischen Revolution bezeichnet, die beiden letzten (1805 und 1806/07) vielfach auch den
Napoleonischen Kriegen zugerechnet.
2
1. KOALITIONSKRIEG (1792-1797)
Österreich und Preußen standen der Französischen Revolution zunächst relativ neutral gegenüber. Als sich in Frankreich jedoch der Druck auf die königliche Familie,
besonders nach deren gescheiterter Flucht nach Varennes, zunehmend verschärfte, erklärten sich Österreich und Preußen am 27. August 1791 in der Deklaration von Pillnitz
bereit, in Frankreich militärisch einzugreifen, um dort die Monarchie zu retten. Nach der Annahme der französischen Verfassung durch Ludwig XVI. am 16. September zog
Kaiser Leopold II. die Deklaration zurück. Die Situation spitzte sich erneut zu, als Frankreich gegen die antirevolutionäre Agitation der Emigranten in Deutschland
protestierte. Am 25. Januar 1792 forderten die Girondisten Österreich ultimativ auf, von einem Eingreifen in Frankreich abzusehen; daraufhin schlossen Österreich und
Preußen ein Defensivbündnis. Ein erneutes französisches Ultimatum, dem zufolge Österreich das Bündnis mit Preußen auflösen sollte, lehnte Österreich am 18. März ab.
Am 20. April 1792 erklärte Ludwig XVI. auf Druck der Girondisten Österreich den Krieg. Preußen stellte sich sogleich auf die Seite Österreichs; das Königreich Sardinien,
Baden und Hessen-Kassel traten der Koalition im September bei. Am 25. Juli 1792 veröffentlichte der Oberbefehlshaber der peußisch-österreichischen Truppen, Herzog Karl
Wilhelm Ferdinand, das Koblenzer Manifest, in dem die Koalition die Wiedereinsetzung einer legalen Regierung, d. h. des Königs, in Frankreich forderte und mit dem die
Koalition ihren bevorstehenden Einmarsch in Frankreich rechtfertigte. In Frankreich bewirkte das Manifest eine weitere Radikalisierung der Revolutuion (siehe Sturm auf die
Tuilerien) und eine Zunahme des Nationalgefühls, wie es sich etwa in der zu jener Zeit entstandenen Marseillaise ausdrückte.
Im August 1792 drangen die Alliierten in Frankreich ein, nahmen am 23. August Longwy und am 2. September Verdun; mit der so genannten Kanonade von Valmy, einem
Artilleriegefecht zwischen den französischen und den alliierten Truppen am 20. September 1792, konnte die französische Armee unter General Dumouriez den Vormarsch
der Koalition jedoch zum Stehen bringen. Die Alliierten zogen sich zurück, die Franzosen begannen vorzustoßen. Im Oktober besetzten französische Truppen unter General
Custine Speyer, Worms, die Kurpfalz und schließlich, am 21. Oktober, Mainz, wo eine Republik nach französischem Vorbild errichtet und der Mainzer Jakobinerklub
gegründet wurde. Am 6. November 1792 siegte Dumouriez bei Jemappes und schloss damit die Besetzung der Österreichischen Niederlande ab; im November annektierte
Frankreich schließlich noch Savoyen.
Am 1. Februar 1793 erklärte Frankreich Großbritannien und den Generalstaaten, am 7. März Spanien den Krieg. Großbritannien, die Niederlande und Spanien schlossen sich
der ersten Koalition an, und am 22. März traten auch die Reichstände dem Krieg gegen Frankreich bei. Geschwächt durch zahlreiche Aufstände im Inneren gegen die
Revolution, u. a. in der Vendée, unterlag Dumouriez am 18. März 1793 bei Neerwinden in Brabant den Österreichern, die die Österreichischen Niederlande zurückeroberten.
Am 23. Juli gewann Preußen nach langer Belagerung Mainz, das sich zur Republik erklärt und am 21. März Frankreich angeschlossen hatte, zurück, und am 27. August
besetzten britische Truppen den Kriegshafen Toulon. Im Dezember 1793 musste Toulon jedoch vor den französischen Belagerern unter Napoleon Bonaparte kapitulieren.
1794 wendete sich das Blatt wieder zugunsten Frankreichs. 1793 hatte Frankreich durch die so genannte Levée en masse unter der Leitung Lazare Carnots umfassend mobil
gemacht, außerdem seine Kriegstaktik geändert, während auf der anderen Seite die Koalition sich nicht immer auf gemeinsames Vorgehen und gemeinsame Ziele einigen
konnte. Die Franzosen gewannen durch ihren Sieg bei Fleurus im Heenegau am 26. Juli 1794 die Österreichischen Niederlande zurück, besetzten erneut das linke Rheinufer
und eroberten im Januar 1795 die Generalstaaten, wo sie als erste Tochterrepublik Frankreichs die Batavische Republik errichteten.
Am 5. April 1795 schloss Preußen mit Frankreich den Basler Frieden, in dem Preußen auf seine linksrheinischen Besitzungen verzichtete und mit dem es aus dem Krieg
ausschied. Spanien schloss sich am 22. Juli dem Friedensschluss an.
Österreich setzte den Krieg fort und errang zunächst auch einige Siege in Süddeutschland. 1796 verlagerte sich dann das Kriegsgeschehen nach Italien. Im Frühjahr 1796
war Napoleon zum Oberbefehlshaber der französischen Truppen in Italien ernannt worden, und innerhalb eines knappen Jahres hatte er hier die Österreicher besiegt und
Oberitalien und die Toskana besetzt: Am 10. Mai siegte er bei Lodi, am 15. Mai schloss Sardinien mit Frankreich Frieden, am 16. Mai wurde Mailand genommen und die
Zisalpinische Republik errichtet. Mitte November 1796 siegten die Franzosen unter Napoleon über die Österreicher bei Arcole und am 14. Januar 1797 bei Rivoli, und am
2. Februar nahmen sie die Festung Mantua ein. Am 19. Februar schloss Frankreich mit dem Kirchenstaat Frieden und gewann dadurch die Romagna, Ferrara und Bologna. In
der Folge stieß Napoleon über Tirol und die Steiermark auf Wien vor und zwang damit Österreich am 18. April 1797 zum Vorfrieden von Leoben, der am 17. Oktober 1797 in
den Frieden von Campo Formio mündete. Österreich trat die Österreichischen Niederlande und Mailand an Frankreich ab und erhielt im Gegenzug Venetien, außerdem
stimmte es der Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich zu.
Von den Staaten der ersten Koalition führte nun allein Großbritannien den Krieg gegen Frankreich weiter.
3
2. KOALITIONSKRIEG (1798-1801/02)
Im Februar 1798 errichtete Frankreich in Italien die Römische Republik und im April die Helvetische Republik; im Mai 1798 brach Napoleon zur Eroberung Ägyptens auf, die
jedoch Anfang August an der französischen Niederlage in der Seeschlacht bei Abukir scheiterte; im Zuge dieser Expedition besetzte Frankreich jedoch Malta. In Reaktion auf
das französische Expansionsstreben kam es Ende 1798/Anfang 1799 zur Bildung der zweiten Koalition, der schließlich Großbritannien, Österreich, das Königreich Neapel,
Russland, Portugal und das Osmanische Reich angehörten.
Der Krieg der zweiten Koalition brach Anfang 1799 in seiner ganzen Heftigkeit aus; er wurde vor allem in Norditalien und in der Schweiz ausgetragen. Österreich und
Russland waren unter dem Oberbefehl des russischen Generals Graf Aleksandr Suworow in Norditalien erfolgreich: Sie besiegten am 5. April 1799 die Franzosen bei
Magnano, am 27. April bei Cassano, am 17. bis 19. Juni an der Trebbia und am 15. August bei Novi. Die Koalition nahm Mailand ein und löste die Zisalpinische Republik auf
und besetzte außerdem Turin. In der Schweiz hatten die Franzosen mehr Erfolg: Nachdem die französischen Truppen bei Zürich Anfang Juni von Erzherzog Karl Ludwig
Johann von Österreich besiegt worden waren, schlugen sie unter General André Masséna am 26. September eine russische Armee unter General Aleksandr Korsakow.
General Suworow führte seine Truppen von Norditalien aus über die Alpen, um Korsakows Truppen in der Schweiz zu verstärken; die waren jedoch bereits besiegt und
aufgelöst. Die Franzosen zwangen Suworow zur Flucht in die Graubündener Berge, wo seine Armee Anfang Herbst durch Kälte und Hunger stark dezimiert wurde. Am
22. Oktober 1799 schied Russland auf Grund von Differenzen mit Österreich, dem es mangelnde Unterstützung vorwarf, aus der zweiten Koalition aus.
Nach seiner Rückkehr aus Ägypten im Oktober 1799 und seinem Staatsstreich am 18. Brumaire (9. November) bot Napoleon, jetzt als Erster Konsul, der Koalition den
Frieden an; die Koalition lehnte jedoch ab. Daraufhin plante Napoleon für Anfang 1800 einen Feldzug gegen Österreich und dessen deutsche Verbündete. Er zog mit einer
neu aufgestellten, 40 000 Mann starken Armee über die Alpen nach Norditalien, eroberte am 2. Juni Mailand zurück, besiegte am 14. Juni die Österreicher in der Schlacht
bei Marengo und brachte Oberitalien wieder unter französische Kontrolle.
Inzwischen waren französische Truppen unter General Jean Victor Moreau über den Rhein nach Süddeutschland vorgedrungen und hatten München besetzt. Am
3. Dezember 1800 besiegte Moreau in der Schlacht bei Hohenlinden in Bayern die letzte österreichische Armee unter Erzherzog Karl Ludwig Johann und rückte nach Linz in
Österreich vor. Österreich, das sich bis zu seiner Niederlage bei Hohenlinden einem Friedensschluss verweigert hatte, willigte nun in einen Frieden ein. Am 9. Februar 1801
bestätigte Kaiser Franz II. für Österreich und das Reich im Frieden von Lunéville die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich (die Entschädigung deutscher Fürsten für
ihre Gebietsverluste links des Rheines wurde 1803 im Reichsdeputationshauptschluss geregelt), erkannte die Batavische, die Helvetische, die Zisalpinische, die Ligurische
Republik sowie das neue Königreich Etrurien an. Es folgten die Friedensschlüsse Frankreichs mit Neapel, Portugal, Russland und dem Osmanischen Reich; zuletzt schloss
Frankreich am 27. März 1802 mit Großbritannien den Frieden von Amiens.
Der Friede von Amiens erwies sich jedoch als wenig dauerhaft. In dem Friedensvertrag war vorgesehen, dass die Briten die Insel Malta, die sie im September 1800
zurückerobert hatten, wieder an die ursprünglichen Besitzer, den Malteserorden, übertragen sollten. Großbritannien aber weigerte sich, die Insel zu räumen, was im Mai
1803 zur Wiederaufnahme des Krieges gegen Frankreich durch Großbritannien führte. Frankreich besetzte das mit Großbritannien in Personalunion verbunde Kurfürstentum
Hannover; auf der anderen Seite schlug Admiral Horatio Nelson am 21. Oktober 1805 die französisch-spanische Flotte bei Trafalgar vernichtend und bestätigte damit
Großbritanniens Vormachtstellung zur See. Ein weiteres Ergebnis dieses Krieges war, dass Napoleon seinen Plan aufgab, in Louisiana in Nordamerika ein französisches
Kolonialreich zu schaffen, weil er seine Kräfte in Europa konzentrieren musste. Stattdessen verkaufte er Louisiana an die USA.
4
3. KOALITIONSKRIEG (1805)
Zur dritten Koalition, die die Wiederherstellung des Kräftegleichgewichts in Europa zum Ziel hatte, fanden sich Großbritannien, Österreich, Schweden und Russland
zusammen. Napoleon, verbündet mit Baden, Württemberg und Bayern, ging rasch gegen die neue Koalition vor. Seit 1798 hatte er in Boulogne am Ärmelkanal Truppen
stehen und allem Anschein nach eine Invasion in England vorbereitet. Im Zuge der französisch-britischen Meinungsverschiedenheiten, die 1803 zum Ausbruch des Krieges
führten, hatte Napoleon die französischen Truppen in Boulogne erheblich verstärkt. Nach der Bildung der dritten Koalition zog er seine Truppen aus Boulogne ab und rückte
nach Bayern vor. Am 17. Oktober 1805 besiegte Napoleon die Österreicher, die in Bayern eingefallen waren, bei Ulm und zwang sie zur Kapitulation. Dann zog er
donauabwärts und besetzte am 13./14. November Wien. Russische Truppen unter General Michail Kutusow und Zar Alexander I. kamen Österreich zu Hilfe, aber Napoleon
konnte die österreich-russischen Armeen am 2. Dezember 1805 in der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz vernichtend schlagen. Österreich kapitulierte erneut und
unterzeichnete am 26. Dezember 1805 den Frieden von Preßburg. Österreich musste Venetien an das Königreich Italien und u. a. Tirol, Vorarlberg, und Passau an Bayern
abtreten; es bekam dafür Salzburg und Berchtesgaden. Die Herzogtümer Württemberg und Bayern wurden als Königreiche anerkannt.
Preußen, das im 3. Koalitionskrieg zunächst neutral geblieben war und nach der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz nicht, wie eigentlich geplant, in den Krieg gegen Frankreich
eingetreten war, schloss am 15. Dezember 1805 mit Frankreich den Vertrag von Schönbrunn, in dem es u. a. Ansbach an Bayern abtrat und dafür Hannover erhielt.
In Italien, wo die französischen Truppen unter Masséna die Österreicher unter Karl Ludwig Johann besiegt hatten, setzte Napoleon seinen älteren Bruder Joseph Bonaparte
1806 als König von Neapel ein. Seinen Bruder Louis Bonaparte machte er zum König von Holland, der ehemaligen Batavischen Republik. Am 12. Juli wurde unter dem
Protektorat Napoleons der Rheinbund gegründet, dem schließlich alle deutschen Staaten außer Österreich, Preußen, Braunschweig und Hessen angehörten. Die Gründung
des Rheinbundes bedeutete das Ende des Heiligen Römischen Reiches und die Vorherrschaft Napoleons im größten Teil Deutschlands.
In Reaktion auf den britischen Seesieg bei Trafalgar begann Napoleon 1806 einen Wirtschaftskrieg gegen Großbritannien: Er verkündete am 21. November 1806 die so
genannte Kontinentalsperre, um Großbritannien zum Frieden zu zwingen, und untersagte damit allen europäischen Staaten den Handel mit Großbritannien. Die britische
Seeherrschaft machte die Durchsetzung der Kontinentalsperre schwierig, und am Ende scheiterte die Blockadepolitik Napoleons.
5
4. KOALITIONSKRIEG (1806/07)
Von einer innerpreußischen Opposition, die sich strikt gegen die preußisch-französische Verbindung wandte, unter Druck gesetzt, näherte sich der preußische König Friedrich
Wilhelm III. Russland an und begann mit der Mobilmachung. Am 26. September 1806 forderte er Napoleon ultimativ auf, seine Truppen aus allen rechtsrheinischen
Gebieten abzuziehen; Napoleon antwortete mit einem Einmarsch in Thüringen und schlug die Preußen, denen sich lediglich Sachsen angeschlossen hatte, in der
Doppelschlacht von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 vernichtend; am 27. Oktober besetzte er Berlin. Sachsen schied am 11. Dezember 1806 nach dem
Sonderfrieden von Posen, den es mit Frankreich geschlossen hatte, aus dem Krieg gegen Frankreich aus; Sachsen wurde Königreich, trat dem Rheinbund bei und bildete ab
1807 eine Personalunion mit dem Herzogtum Warschau, das durch den Frieden von Tilsit errichtet wurde.
Friedrich Wilhelm III., der sich nach Ostpreußen zurückgezogen hatte, führte den Krieg mit russischer Hilfe weiter. Das erste französisch-russische Zusammentreffen bei
Preußisch Eylau am 7./8. Februar 1807 endete noch unentschieden; in der Schlacht bei Friedland am 14. Juni 1807 schlug Napoleon die Russen entscheidend und zwang Zar
Alexander I. und Friedrich Wilhelm III. zum Frieden von Tilsit (7./9. Juli 1807). Preußen wurde zu einer drittrangigen Macht degradiert; es verlor fast die Hälfte seines
Territoriums und wurde durch hohe Reparationen, die französische Besatzung und eine starke Reduzierung seines stehenden Heeres praktisch lahm gelegt.
Russland, nun mit Frankreich verbündet, eroberte 1808 Finnland von Schweden, woraufhin Gustav IV. Adolf von Schweden zugunsten seines Onkels Karl XIII. abdanken
musste. Als Gegenleistung dafür, dass er Schweden nicht militärisch bedrohte, forderte Napoleon, dass Karl den General Jean Baptiste Jules Bernadotte, einen Marschall
Napoleons, zu seinem Erben machte; Bernadotte wurde 1818 als Karl XIV. Johann König von Schweden.
Nach dem Frieden von Tilsit stand Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht; als ernsthafter Gegner war in Europa nur noch Großbritannien übrig geblieben. Napoleons
Hegemonialstellung in Europa wurde jedoch durch den Spanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die französische Fremdherrschaft und in der Folge durch weitere nationale
Erhebungen in Frage gestellt. In den Napoleonischen Kriegen suchte Napoleon, seine Position in Europa zu behaupten.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Koalitionskriege - Geschichte.
1
EINLEITUNG
Koalitionskriege, die Kriege wechselnder Koalitionen europäischer Staaten gegen das revolutionäre bzw. das napoleonische Frankreich von 1792 bis 1807. Die beiden ersten
Kriege (1792-1797 und 1798-1801/02) werden auch als Kriege der Französischen Revolution bezeichnet, die beiden letzten (1805 und 1806/07) vielfach auch den
Napoleonischen Kriegen zugerechnet.
2
1. KOALITIONSKRIEG (1792-1797)
Österreich und Preußen standen der Französischen Revolution zunächst relativ neutral gegenüber. Als sich in Frankreich jedoch der Druck auf die königliche Familie,
besonders nach deren gescheiterter Flucht nach Varennes, zunehmend verschärfte, erklärten sich Österreich und Preußen am 27. August 1791 in der Deklaration von Pillnitz
bereit, in Frankreich militärisch einzugreifen, um dort die Monarchie zu retten. Nach der Annahme der französischen Verfassung durch Ludwig XVI. am 16. September zog
Kaiser Leopold II. die Deklaration zurück. Die Situation spitzte sich erneut zu, als Frankreich gegen die antirevolutionäre Agitation der Emigranten in Deutschland
protestierte. Am 25. Januar 1792 forderten die Girondisten Österreich ultimativ auf, von einem Eingreifen in Frankreich abzusehen; daraufhin schlossen Österreich und
Preußen ein Defensivbündnis. Ein erneutes französisches Ultimatum, dem zufolge Österreich das Bündnis mit Preußen auflösen sollte, lehnte Österreich am 18. März ab.
Am 20. April 1792 erklärte Ludwig XVI. auf Druck der Girondisten Österreich den Krieg. Preußen stellte sich sogleich auf die Seite Österreichs; das Königreich Sardinien,
Baden und Hessen-Kassel traten der Koalition im September bei. Am 25. Juli 1792 veröffentlichte der Oberbefehlshaber der peußisch-österreichischen Truppen, Herzog Karl
Wilhelm Ferdinand, das Koblenzer Manifest, in dem die Koalition die Wiedereinsetzung einer legalen Regierung, d. h. des Königs, in Frankreich forderte und mit dem die
Koalition ihren bevorstehenden Einmarsch in Frankreich rechtfertigte. In Frankreich bewirkte das Manifest eine weitere Radikalisierung der Revolutuion (siehe Sturm auf die
Tuilerien) und eine Zunahme des Nationalgefühls, wie es sich etwa in der zu jener Zeit entstandenen Marseillaise ausdrückte.
Im August 1792 drangen die Alliierten in Frankreich ein, nahmen am 23. August Longwy und am 2. September Verdun; mit der so genannten Kanonade von Valmy, einem
Artilleriegefecht zwischen den französischen und den alliierten Truppen am 20. September 1792, konnte die französische Armee unter General Dumouriez den Vormarsch
der Koalition jedoch zum Stehen bringen. Die Alliierten zogen sich zurück, die Franzosen begannen vorzustoßen. Im Oktober besetzten französische Truppen unter General
Custine Speyer, Worms, die Kurpfalz und schließlich, am 21. Oktober, Mainz, wo eine Republik nach französischem Vorbild errichtet und der Mainzer Jakobinerklub
gegründet wurde. Am 6. November 1792 siegte Dumouriez bei Jemappes und schloss damit die Besetzung der Österreichischen Niederlande ab; im November annektierte
Frankreich schließlich noch Savoyen.
Am 1. Februar 1793 erklärte Frankreich Großbritannien und den Generalstaaten, am 7. März Spanien den Krieg. Großbritannien, die Niederlande und Spanien schlossen sich
der ersten Koalition an, und am 22. März traten auch die Reichstände dem Krieg gegen Frankreich bei. Geschwächt durch zahlreiche Aufstände im Inneren gegen die
Revolution, u. a. in der Vendée, unterlag Dumouriez am 18. März 1793 bei Neerwinden in Brabant den Österreichern, die die Österreichischen Niederlande zurückeroberten.
Am 23. Juli gewann Preußen nach langer Belagerung Mainz, das sich zur Republik erklärt und am 21. März Frankreich angeschlossen hatte, zurück, und am 27. August
besetzten britische Truppen den Kriegshafen Toulon. Im Dezember 1793 musste Toulon jedoch vor den französischen Belagerern unter Napoleon Bonaparte kapitulieren.
1794 wendete sich das Blatt wieder zugunsten Frankreichs. 1793 hatte Frankreich durch die so genannte Levée en masse unter der Leitung Lazare Carnots umfassend mobil
gemacht, außerdem seine Kriegstaktik geändert, während auf der anderen Seite die Koalition sich nicht immer auf gemeinsames Vorgehen und gemeinsame Ziele einigen
konnte. Die Franzosen gewannen durch ihren Sieg bei Fleurus im Heenegau am 26. Juli 1794 die Österreichischen Niederlande zurück, besetzten erneut das linke Rheinufer
und eroberten im Januar 1795 die Generalstaaten, wo sie als erste Tochterrepublik Frankreichs die Batavische Republik errichteten.
Am 5. April 1795 schloss Preußen mit Frankreich den Basler Frieden, in dem Preußen auf seine linksrheinischen Besitzungen verzichtete und mit dem es aus dem Krieg
ausschied. Spanien schloss sich am 22. Juli dem Friedensschluss an.
Österreich setzte den Krieg fort und errang zunächst auch einige Siege in Süddeutschland. 1796 verlagerte sich dann das Kriegsgeschehen nach Italien. Im Frühjahr 1796
war Napoleon zum Oberbefehlshaber der französischen Truppen in Italien ernannt worden, und innerhalb eines knappen Jahres hatte er hier die Österreicher besiegt und
Oberitalien und die Toskana besetzt: Am 10. Mai siegte er bei Lodi, am 15. Mai schloss Sardinien mit Frankreich Frieden, am 16. Mai wurde Mailand genommen und die
Zisalpinische Republik errichtet. Mitte November 1796 siegten die Franzosen unter Napoleon über die Österreicher bei Arcole und am 14. Januar 1797 bei Rivoli, und am
2. Februar nahmen sie die Festung Mantua ein. Am 19. Februar schloss Frankreich mit dem Kirchenstaat Frieden und gewann dadurch die Romagna, Ferrara und Bologna. In
der Folge stieß Napoleon über Tirol und die Steiermark auf Wien vor und zwang damit Österreich am 18. April 1797 zum Vorfrieden von Leoben, der am 17. Oktober 1797 in
den Frieden von Campo Formio mündete. Österreich trat die Österreichischen Niederlande und Mailand an Frankreich ab und erhielt im Gegenzug Venetien, außerdem
stimmte es der Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich zu.
Von den Staaten der ersten Koalition führte nun allein Großbritannien den Krieg gegen Frankreich weiter.
3
2. KOALITIONSKRIEG (1798-1801/02)
Im Februar 1798 errichtete Frankreich in Italien die Römische Republik und im April die Helvetische Republik; im Mai 1798 brach Napoleon zur Eroberung Ägyptens auf, die
jedoch Anfang August an der französischen Niederlage in der Seeschlacht bei Abukir scheiterte; im Zuge dieser Expedition besetzte Frankreich jedoch Malta. In Reaktion auf
das französische Expansionsstreben kam es Ende 1798/Anfang 1799 zur Bildung der zweiten Koalition, der schließlich Großbritannien, Österreich, das Königreich Neapel,
Russland, Portugal und das Osmanische Reich angehörten.
Der Krieg der zweiten Koalition brach Anfang 1799 in seiner ganzen Heftigkeit aus; er wurde vor allem in Norditalien und in der Schweiz ausgetragen. Österreich und
Russland waren unter dem Oberbefehl des russischen Generals Graf Aleksandr Suworow in Norditalien erfolgreich: Sie besiegten am 5. April 1799 die Franzosen bei
Magnano, am 27. April bei Cassano, am 17. bis 19. Juni an der Trebbia und am 15. August bei Novi. Die Koalition nahm Mailand ein und löste die Zisalpinische Republik auf
und besetzte außerdem Turin. In der Schweiz hatten die Franzosen mehr Erfolg: Nachdem die französischen Truppen bei Zürich Anfang Juni von Erzherzog Karl Ludwig
Johann von Österreich besiegt worden waren, schlugen sie unter General André Masséna am 26. September eine russische Armee unter General Aleksandr Korsakow.
General Suworow führte seine Truppen von Norditalien aus über die Alpen, um Korsakows Truppen in der Schweiz zu verstärken; die waren jedoch bereits besiegt und
aufgelöst. Die Franzosen zwangen Suworow zur Flucht in die Graubündener Berge, wo seine Armee Anfang Herbst durch Kälte und Hunger stark dezimiert wurde. Am
22. Oktober 1799 schied Russland auf Grund von Differenzen mit Österreich, dem es mangelnde Unterstützung vorwarf, aus der zweiten Koalition aus.
Nach seiner Rückkehr aus Ägypten im Oktober 1799 und seinem Staatsstreich am 18. Brumaire (9. November) bot Napoleon, jetzt als Erster Konsul, der Koalition den
Frieden an; die Koalition lehnte jedoch ab. Daraufhin plante Napoleon für Anfang 1800 einen Feldzug gegen Österreich und dessen deutsche Verbündete. Er zog mit einer
neu aufgestellten, 40 000 Mann starken Armee über die Alpen nach Norditalien, eroberte am 2. Juni Mailand zurück, besiegte am 14. Juni die Österreicher in der Schlacht
bei Marengo und brachte Oberitalien wieder unter französische Kontrolle.
Inzwischen waren französische Truppen unter General Jean Victor Moreau über den Rhein nach Süddeutschland vorgedrungen und hatten München besetzt. Am
3. Dezember 1800 besiegte Moreau in der Schlacht bei Hohenlinden in Bayern die letzte österreichische Armee unter Erzherzog Karl Ludwig Johann und rückte nach Linz in
Österreich vor. Österreich, das sich bis zu seiner Niederlage bei Hohenlinden einem Friedensschluss verweigert hatte, willigte nun in einen Frieden ein. Am 9. Februar 1801
bestätigte Kaiser Franz II. für Österreich und das Reich im Frieden von Lunéville die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich (die Entschädigung deutscher Fürsten für
ihre Gebietsverluste links des Rheines wurde 1803 im Reichsdeputationshauptschluss geregelt), erkannte die Batavische, die Helvetische, die Zisalpinische, die Ligurische
Republik sowie das neue Königreich Etrurien an. Es folgten die Friedensschlüsse Frankreichs mit Neapel, Portugal, Russland und dem Osmanischen Reich; zuletzt schloss
Frankreich am 27. März 1802 mit Großbritannien den Frieden von Amiens.
Der Friede von Amiens erwies sich jedoch als wenig dauerhaft. In dem Friedensvertrag war vorgesehen, dass die Briten die Insel Malta, die sie im September 1800
zurückerobert hatten, wieder an die ursprünglichen Besitzer, den Malteserorden, übertragen sollten. Großbritannien aber weigerte sich, die Insel zu räumen, was im Mai
1803 zur Wiederaufnahme des Krieges gegen Frankreich durch Großbritannien führte. Frankreich besetzte das mit Großbritannien in Personalunion verbunde Kurfürstentum
Hannover; auf der anderen Seite schlug Admiral Horatio Nelson am 21. Oktober 1805 die französisch-spanische Flotte bei Trafalgar vernichtend und bestätigte damit
Großbritanniens Vormachtstellung zur See. Ein weiteres Ergebnis dieses Krieges war, dass Napoleon seinen Plan aufgab, in Louisiana in Nordamerika ein französisches
Kolonialreich zu schaffen, weil er seine Kräfte in Europa konzentrieren musste. Stattdessen verkaufte er Louisiana an die USA.
4
3. KOALITIONSKRIEG (1805)
Zur dritten Koalition, die die Wiederherstellung des Kräftegleichgewichts in Europa zum Ziel hatte, fanden sich Großbritannien, Österreich, Schweden und Russland
zusammen. Napoleon, verbündet mit Baden, Württemberg und Bayern, ging rasch gegen die neue Koalition vor. Seit 1798 hatte er in Boulogne am Ärmelkanal Truppen
stehen und allem Anschein nach eine Invasion in England vorbereitet. Im Zuge der französisch-britischen Meinungsverschiedenheiten, die 1803 zum Ausbruch des Krieges
führten, hatte Napoleon die französischen Truppen in Boulogne erheblich verstärkt. Nach der Bildung der dritten Koalition zog er seine Truppen aus Boulogne ab und rückte
nach Bayern vor. Am 17. Oktober 1805 besiegte Napoleon die Österreicher, die in Bayern eingefallen waren, bei Ulm und zwang sie zur Kapitulation. Dann zog er
donauabwärts und besetzte am 13./14. November Wien. Russische Truppen unter General Michail Kutusow und Zar Alexander I. kamen Österreich zu Hilfe, aber Napoleon
konnte die österreich-russischen Armeen am 2. Dezember 1805 in der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz vernichtend schlagen. Österreich kapitulierte erneut und
unterzeichnete am 26. Dezember 1805 den Frieden von Preßburg. Österreich musste Venetien an das Königreich Italien und u. a. Tirol, Vorarlberg, und Passau an Bayern
abtreten; es bekam dafür Salzburg und Berchtesgaden. Die Herzogtümer Württemberg und Bayern wurden als Königreiche anerkannt.
Preußen, das im 3. Koalitionskrieg zunächst neutral geblieben war und nach der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz nicht, wie eigentlich geplant, in den Krieg gegen Frankreich
eingetreten war, schloss am 15. Dezember 1805 mit Frankreich den Vertrag von Schönbrunn, in dem es u. a. Ansbach an Bayern abtrat und dafür Hannover erhielt.
In Italien, wo die französischen Truppen unter Masséna die Österreicher unter Karl Ludwig Johann besiegt hatten, setzte Napoleon seinen älteren Bruder Joseph Bonaparte
1806 als König von Neapel ein. Seinen Bruder Louis Bonaparte machte er zum König von Holland, der ehemaligen Batavischen Republik. Am 12. Juli wurde unter dem
Protektorat Napoleons der Rheinbund gegründet, dem schließlich alle deutschen Staaten außer Österreich, Preußen, Braunschweig und Hessen angehörten. Die Gründung
des Rheinbundes bedeutete das Ende des Heiligen Römischen Reiches und die Vorherrschaft Napoleons im größten Teil Deutschlands.
In Reaktion auf den britischen Seesieg bei Trafalgar begann Napoleon 1806 einen Wirtschaftskrieg gegen Großbritannien: Er verkündete am 21. November 1806 die so
genannte Kontinentalsperre, um Großbritannien zum Frieden zu zwingen, und untersagte damit allen europäischen Staaten den Handel mit Großbritannien. Die britische
Seeherrschaft machte die Durchsetzung der Kontinentalsperre schwierig, und am Ende scheiterte die Blockadepolitik Napoleons.
5
4. KOALITIONSKRIEG (1806/07)
Von einer innerpreußischen Opposition, die sich strikt gegen die preußisch-französische Verbindung wandte, unter Druck gesetzt, näherte sich der preußische König Friedrich
Wilhelm III. Russland an und begann mit der Mobilmachung. Am 26. September 1806 forderte er Napoleon ultimativ auf, seine Truppen aus allen rechtsrheinischen
Gebieten abzuziehen; Napoleon antwortete mit einem Einmarsch in Thüringen und schlug die Preußen, denen sich lediglich Sachsen angeschlossen hatte, in der
Doppelschlacht von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 vernichtend; am 27. Oktober besetzte er Berlin. Sachsen schied am 11. Dezember 1806 nach dem
Sonderfrieden von Posen, den es mit Frankreich geschlossen hatte, aus dem Krieg gegen Frankreich aus; Sachsen wurde Königreich, trat dem Rheinbund bei und bildete ab
1807 eine Personalunion mit dem Herzogtum Warschau, das durch den Frieden von Tilsit errichtet wurde.
Friedrich Wilhelm III., der sich nach Ostpreußen zurückgezogen hatte, führte den Krieg mit russischer Hilfe weiter. Das erste französisch-russische Zusammentreffen bei
Preußisch Eylau am 7./8. Februar 1807 endete noch unentschieden; in der Schlacht bei Friedland am 14. Juni 1807 schlug Napoleon die Russen entscheidend und zwang Zar
Alexander I. und Friedrich Wilhelm III. zum Frieden von Tilsit (7./9. Juli 1807). Preußen wurde zu einer drittrangigen Macht degradiert; es verlor fast die Hälfte seines
Territoriums und wurde durch hohe Reparationen, die französische Besatzung und eine starke Reduzierung seines stehenden Heeres praktisch lahm gelegt.
Russland, nun mit Frankreich verbündet, eroberte 1808 Finnland von Schweden, woraufhin Gustav IV. Adolf von Schweden zugunsten seines Onkels Karl XIII. abdanken
musste. Als Gegenleistung dafür, dass er Schweden nicht militärisch bedrohte, forderte Napoleon, dass Karl den General Jean Baptiste Jules Bernadotte, einen Marschall
Napoleons, zu seinem Erben machte; Bernadotte wurde 1818 als Karl XIV. Johann König von Schweden.
Nach dem Frieden von Tilsit stand Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht; als ernsthafter Gegner war in Europa nur noch Großbritannien übrig geblieben. Napoleons
Hegemonialstellung in Europa wurde jedoch durch den Spanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die französische Fremdherrschaft und in der Folge durch weitere nationale
Erhebungen in Frage gestellt. In den Napoleonischen Kriegen suchte Napoleon, seine Position in Europa zu behaupten.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Hegels Philosophie der Geschichte und Goethes Anschauung des Geschehens der Welt
- Mohandas Gandhi - Geschichte.
- Dekolonisation - Geschichte.
- Wiener Kongress - Geschichte.
- Zweiter Weltkrieg - Geschichte.